| |
 Ratgeber:
Ratgeber:

|
.
Canine Leishmaniose
-
-
Leishmaniose beim Hund
Die Leishmaniose ist eine
Infektionskrankheit, die weltweit bei Mensch und Tier durch protozoische
Parasiten (Geißeltierchen) der Gattung Leishmania ausgelöst wird.
Verbreitungsgebiet sind die Tropen, Südamerika, Afrika, Asien und der
Mittelmeerraum. Thema ist hier die
Leishmaniose beim Hund im europäischen Mittelmeerraum.
Übertragungsweg
Die Übertragung erfolgt ausschließlich über die
Sandmücke (Phlebotomus)
als Vektor. Eine direkte Übertragung z.B. von Hund zu
Hund ist praktisch ausgeschlossen, außer z.T. nachgewiesene Übertragungen
direkt im Mutterleib auf die Welpen und beim Deckackt. Bei ihrer Blutmahlzeit übertragen die
Mücken die Leishmanien in Haut und Blut des Hundes. Dort siedeln sich die
Leishmanien in den weißen Blutkörperchen (Makrophagen) an, die für das
Immunsystem verantwortlich sind, und vermehren sich in ihnen. Danach
sprengen sie die Zellen, zerstören so immer mehr Abwehrzellen und wandern
weiter in Lymphknoten, Rückenmark, Milz und Leber.
Verhalten der Mücken
Die Sandmücken sind hellsandfarben, sehr
klein (ca. 2 mm), leicht behaart und summen nicht. Aufgrund ihrer Größe
fliegen sie nicht bei Wind und nicht in großer Flughöhe, in direkter
Küstennähe sind sie meist nicht zu finden, dafür vermehrt im Hinterland. Sie
fliegen erst ab 16 Grad (ca. April bis November) ab Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang, wobei das Infektionsrisiko zum Ende des Sommers hin zunimmt.
Da sie bis zu 5 Minuten zum Blutsaugen brauchen und ihr Stich schmerzhaft
ist, fliegen sie zumeist nur schlafende Opfer an. Bei Hunden landen sie
zumeist auf dem Rücken und wandern dann in Richtung der unbehaarten Nase,
Ohren oder Bauchgegend.
 |
 |
Phlebotomus sp. - Losar de la Vera
(Caceres, Spanien)
© Luis
Fernandez Garcia - CC
ca.
20-fache Vergrößerung
|
Vorbeugung ist das A+O
- Hund ab Sonnenuntergang nicht im Freien
schlafen lassen
- Mückenabwehr durch das
Scalibor-Protectorband®
(Wirkung 6 Monate)
- oder permethrinhaltige SpotOn (Exspot®
oder
Advantix® = Wirkung 3
Wochen)
- Glühbirnen gegen Neonröhren oder
Sparlampen austauschen
- kleinmaschige Mückennetze verwenden
- Klimaanlage / Ventilator einschalten
- evtl. Impfung (s.u.)
-
präventive Immunsteuerung im Frühjahr und
Herbst mit Leisguard®
Esteve
Impfung seit 02/2011
Seit
2011 gibt es einen Impfstoff von Virbac
CaniLeish®,
der das Risiko einer aktiven Infektion bzw. der Ausbildung einer Erkrankung
durch L. infantum um 3,6 bis 4 mal vermindern soll. Er kann die Infektion
nicht verhindern, den Verlauf aber abmildern. Er darf nicht
in bereits infizierte Tiere verbracht werden, Schnelltests auf Antikörper
ergeben jedoch häufig ein positiv wie negativ falsches Ergebnis. Sie kann
bei Tieren ab einem Alter von 6 Monaten erfolgen, die Erstimpfung erfolgt 3
mal im Abstand von 3 Wochen (Grundimmunisierung), danach jährliche
Wiederholungsimpfungen. Die Wirkdauer beginnt erst 4 Wochen nach der letzten
3fach Impfung (also erst 10 Wochen nach Beginn der Grundimmunisierung) und
beträgt 1 Jahr. Berichte über auftretende starke Nebenwirkungen liegen bereits vor,
besonders bei Hunden unter 10 Kg. Zur Zeit gehört die Impfung Canileish zu
den Impfungen mit den höchsten Impfrisiken. Die Entscheidung zur Impfung liegt bei jedem Hundehalter
selbst und sollte unter absoluter Nutzen-Risiko-Abwägung getroffen werden. Eventuell ist ein guter und sorgfältiger Mückenschutz weniger
risikobehafted und genauso effektiv. Die Impfung ersetzt den Mückenschutz nicht!
Seite auf facebook,
auf der Betroffene die aufgetretenen schweren
Nebenwirkungen bei ihren Hunden beklagen:
https://www.facebook.com/ContraLaVacunaDeLaLeishmania
Warum erkranken einige Hunde, andere
nicht?
Je
nach Immunkompetenz des Hundes verläuft die Infektion. Bei vorzugsweiser
Aktivierung einer zellvermittelten Immunantwort durch T1-Helferzellen,
werden die Makrophagen (Abwehrzellen der weißen Blutkörperchen) stimuliert,
die bereits infizierten Zellen zu zerstören und die Infektion kann
ausheilen. Wird die zellulare Abwehr der Makrophagen jedoch übergangen, so
erfolgt eine immunglobulin-vermittelte Immunantwort als humorale Abwehr
(T2-Helferzellen), bei
der Antikörper gebildet werden, die jedoch bei der Eleminierung der Erreger
in den Makrophagen versagen, so dass sich die Infektion weiter ausbreitet
und die Erkrankung ausbricht. Warum bei den einen Hunden das Immunsystem den
Weg vermehrt über TH1 bei anderen vermehrt über TH2 wählt, ist bis heute
immer noch ein Mysterium. Angenommen wird jedoch, dass sich bei der ersten
Gruppe bereits gewisse genetische Resistenzen gegen die Parasiten gebildet hatten.
Erstaunlich ist, dass die Leishmaniose nur bei ca. 10% der nachweislich
infizierten Hunde ausbricht.
Viszerale
Leishmaniose
In den Mittelmeerländern kommt beim Hund
ausschließlich die viszerale
(innere) Leishmaniose
vor, übertragen durch den Vektor Phlebotomus mit dem Leishmania-Stamm Leishmania
infantum. Eventuell auftretende
Hautläsionen weisen auch nicht auf eine kutane Form hin, sondern sind nur
Sekundärerscheinungen des inneren Prozesses. Hierbei wird durch die
Zerstörung der Immunabwehr und die Ansiedelung der Parasiten in den Organen,
der Gesamtkomplex des Körpers so geschwächt und ausgezehrt, dass die Hunde
ohne entsprechende Behandlung meist an Sekundärinfektionen, Blutungen oder
Nierenversagen sterben. Mit einer rechtzeitigen medikamentösen Behandlung
verläuft die Erkrankung jedoch selten tödlich.
Symptome
Die Symptome sind vielfältig und die meisten können auch symptomatisch bei
anderen Krankheiten sein. Besonders äußerlich sichtbare Sekundär-Symptome
können, müssen jedoch nicht auftreten. Die meisten Hunde weisen sogar am
Anfang der Erkrankung eben für den Laien überhaupt keine erkennbaren
Symptome auf.
Erste Auffälligkeiten sind meist:
-
Apathie, Gewichtsverlust, Appetitmangel, Durchfälle
-
Fellveränderungen, Schuppenbildung, Haarausfall
-
Hautentzündungen an Gelenken und Übergang zu Schleimhäuten
-
geschwollene Lymphknoten, Leber und Milz, Fieber
-
starke Krallenbildung, ulcerose Augenlinsen
Testverfahren
.
Indirekte Testverfahren:
Der erste Nachweis erfolgt zumeist über
Blutserum (IFI, IFA, Elisa) bei denen die gebildeten Antikörper durch
Immunfluoreszenz oder enzymatischer Farbreaktion nachgewiesen werden. Diese
Verfahren sind zwar relativ günstig, leider liegt die Sensitivität der
Verfahren besonders bei schwachen Titern nur bei ca. 80-90%, so dass falsch Befunde z.T. vorkommen können. Außerdem kommen von Labor zu Labor variierende
Grenzwerte vor. Bei korrektem Befund lassen sich folgende Aussagen treffen:
negativ:
-
der Hund
ist nicht infiziert,
oder
-
der Hund ist infiziert, die zellvermittelte Immunantwort Typ Th1
ist (noch) erfolgreich in der Eliminierung des Parasiten.
zweifelhaft:
-
der Hund
ist nicht infiziert, eine Kreuzreaktion mit Antikörpern anderer
Infektionen ist möglich, oder
-
der Hund ist infiziert, noch überwiegt die zellvermittelte
Immunantwort Typ Th1 gegenüber der humoralen
immunglobulinen Immunantwort Typ Th2, oder
-
der Hund befindet sich bereits in der Phase des Ausheilens.
positiv:
-
der Hund
ist sehr jung und ihm wurden die Antikörper durch die Mutter
übergeben und sind noch nicht abgebaut worden, oder
-
der Hund wurde infiziert und hat Antikörper
aufgrund der Immunantwort Typ Th2 gebildet, ein mittlerer bis
hoher Titer zusammen mit anderen Parametern lässt auf den
Ausbruch der Erkrankung schließen, oder
-
der Hund ist infiziert und war erkrankt, nach leishmanizider
Behandlung haben sich die Antikörper jedoch (noch) nicht
abgebaut.
Direkte Testverfahren:
Eine Möglichkeit ist der direkte
Erregernachweis aus Punktaten oder Biopsien entweder aus dem Rückenmark,
Lymphknoten, Milz oder aus ulcerativen Hautveränderungen. Die Sensitivität
ist stark abhängig von der Beschaffenheit des Probenmaterials und daher das
Ergebnis mit Vorsicht zu betrachten.
Ein weiteres Testverfahren ist die PCR
(Polymerase Kettenreaktion), bei der molekularbiologisch die DNA des
Erregers in-vitro nachgewiesen wird aus kleinster Menge Probenmaterial aus
Lymphknoten oder Rückenmark. Hierbei wird, soweit die DNA-Sequenz von L.
infantum bekannt ist, eine Sensitivität von 100 % erreicht. Die PCR ist
jedoch relativ invasiv und mit hohen Kosten verbunden, so dass sie zumeist
erst eingesetzt wird, wenn alle Diagnoseverfahren zuvor kein klares Bild
ergeben haben. Ein negatives Ergebnis gibt jedoch nur an, dass in diesem
Probenmaterial kein Parasit nachgewiesen werden konnte.
Direkte Testverfahren weisen
insgesamt nur die Infektion nach, nicht die Erkrankung. Sie sind daher nur
bei unklaren Ergebnissen oder zur Therapiekontrolle sinnvoll.
Diagnose
Um
nun eine sichere Bestimmung des Gesundheitszustandes bzw. dem Stand des
Infektionsgeschehens des Tieres vorzunehmen, benötigt man bei auftretenden
Symptomen oder bei einem positiven Antikörper-Titer
-
ein großes Blutbild
-
incl. der Leber- und Nierenwerte
-
und einer Eiweiß-Elektrophorese (Proteinogram), incl. Kurve.
Betrachtet man nun das Blutbild, so weisen
-
niedrige Hämatokritwerte
-
niedrige Hämoglobinwerte
-
niedriger Albumin/Globulin Quotient
-
stark angestiegene Protein-Gammawerte
auf einen bereits erfolgten Ausbruch der Erkrankung hin. Sind diese Werte
noch nicht signifikant, so bedeutet dies nicht, dass der Hund keine
Erkrankung bekommen wird. Hier muss der körperliche Zustand zzgl.
vorhandener Symptome und der Antikörper-Titer mit in die Betrachtung
einfließen, um ein Gesamtbild zu erhalten, da es meist keine
einheitliche klinische Symptomatik gibt.
Dies liegt im Grunde daran, dass der
Parasit selbst gar nicht daran interessiert ist, seinen Wirt zu töten. Die
schlimmste Gefahr bei einer ausbrechenden Leishmaniose ist immer die
Überreaktion des Immunsystems (hohe Antikörper), das die Gewebeschäden erst
auslöst.
Fazit:
Eine Diagnose-Stellung und Beurteilung des Krankheitsgeschehens ist schwer
und sollte nur durch mit Leishmaniose vertraute Fachleute gestellt werden.
Nun gibt
es endlich den ersten Ratgeber in deutscher Sprache:
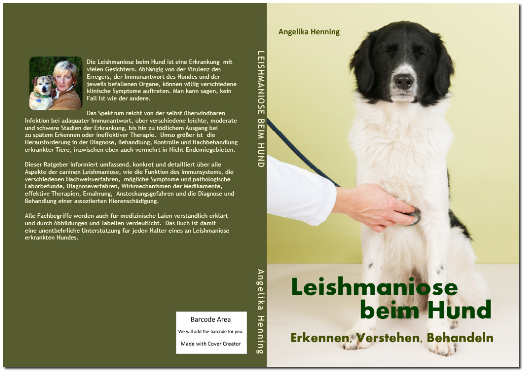 bestellen bei Amazon >>>
Die namentliche Nennung von
Arzneimitteln sowie Angaben zu Dosierungen, Therapien und
Behandlungen auf dieser Webseite sind keinesfalls als Empfehlung
im konkreten Fall anzusehen, noch sind diese Informationen als abschließend zu betrachten.
Sie ersetzen weder tierärztliche, ärztliche noch sonstige
Fachberatung. Insbesondere hinsichtlich Nebenwirkungen,
Gegenanzeigen und sonstigen Informationen ist der behandelnde
Tierarzt oder Apotheker beizuziehen.
bestellen bei Amazon >>>
Die namentliche Nennung von
Arzneimitteln sowie Angaben zu Dosierungen, Therapien und
Behandlungen auf dieser Webseite sind keinesfalls als Empfehlung
im konkreten Fall anzusehen, noch sind diese Informationen als abschließend zu betrachten.
Sie ersetzen weder tierärztliche, ärztliche noch sonstige
Fachberatung. Insbesondere hinsichtlich Nebenwirkungen,
Gegenanzeigen und sonstigen Informationen ist der behandelnde
Tierarzt oder Apotheker beizuziehen.
 nach
oben nach
oben
|
.

|
|
 Ratgeber:
Ratgeber:

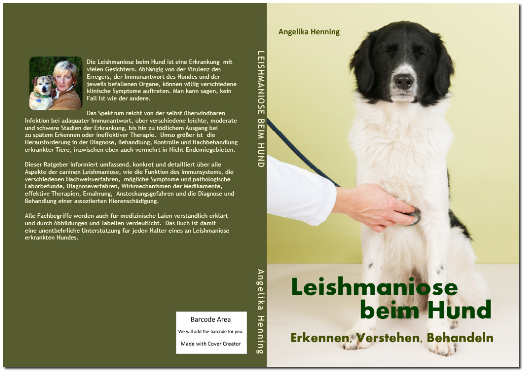 bestellen bei Amazon >>>
Die namentliche Nennung von
Arzneimitteln sowie Angaben zu Dosierungen, Therapien und
Behandlungen auf dieser Webseite sind keinesfalls als Empfehlung
im konkreten Fall anzusehen, noch sind diese Informationen als abschließend zu betrachten.
Sie ersetzen weder tierärztliche, ärztliche noch sonstige
Fachberatung. Insbesondere hinsichtlich Nebenwirkungen,
Gegenanzeigen und sonstigen Informationen ist der behandelnde
Tierarzt oder Apotheker beizuziehen.
bestellen bei Amazon >>>
Die namentliche Nennung von
Arzneimitteln sowie Angaben zu Dosierungen, Therapien und
Behandlungen auf dieser Webseite sind keinesfalls als Empfehlung
im konkreten Fall anzusehen, noch sind diese Informationen als abschließend zu betrachten.
Sie ersetzen weder tierärztliche, ärztliche noch sonstige
Fachberatung. Insbesondere hinsichtlich Nebenwirkungen,
Gegenanzeigen und sonstigen Informationen ist der behandelnde
Tierarzt oder Apotheker beizuziehen.
